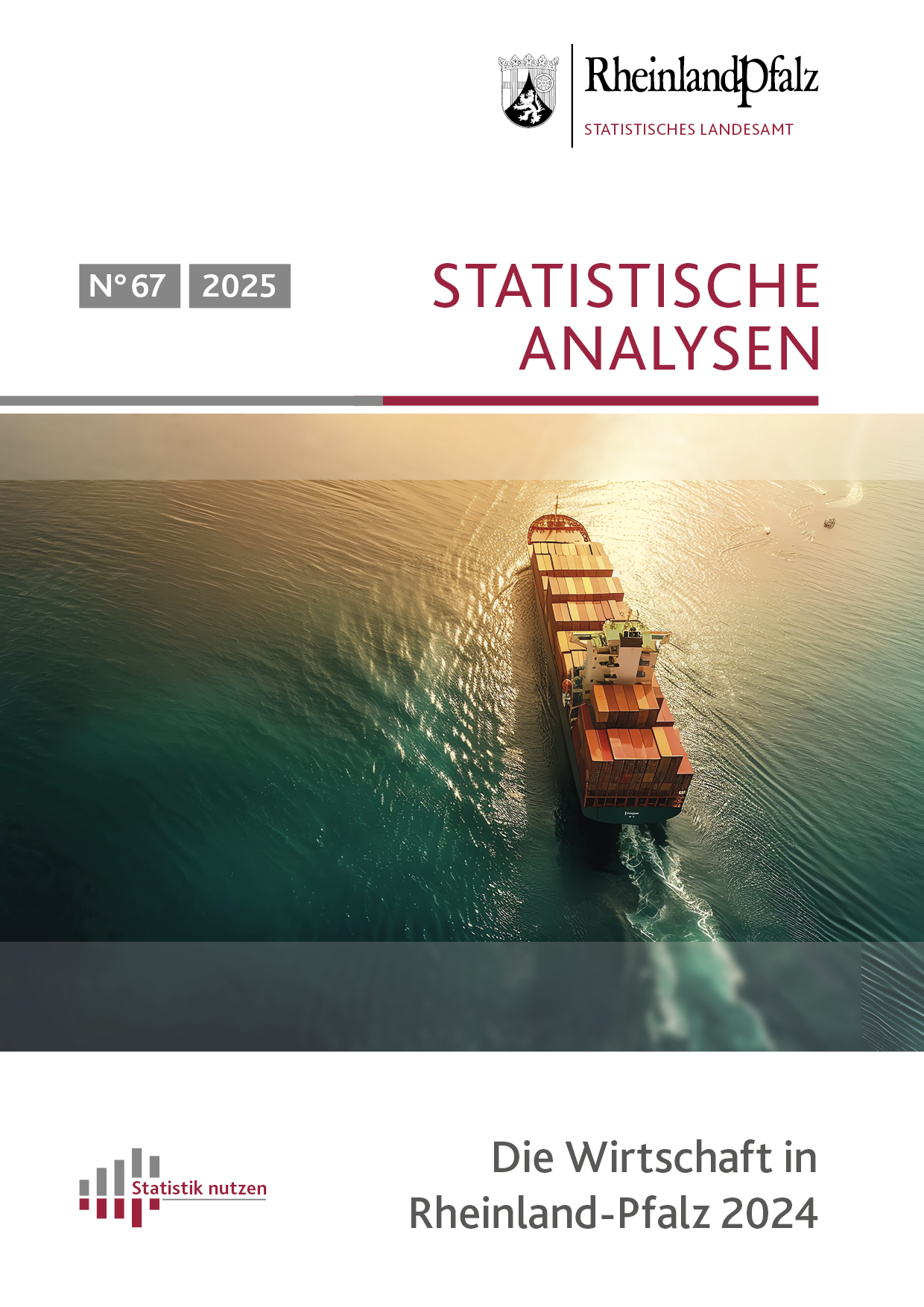Volkswirtschaft: Analysen
Analyse: Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz im Jahr 2024 – Wirtschaftsentwicklung durch schwierige Rahmenbedingungen geprägt
Die wirtschaftliche Entwicklung wurde auch 2024 von hohen Energiekosten, ungünstigen Finanzierungsbedingungen, geopolitischen Krisen und unsicheren wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigt. Dies wirkte sich insbesondere auf die Entwicklung der Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe aus. Nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, in dem das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mitwirkt, nahm das Bruttoinlandprodukt preisbereinigt um 1,1 Prozent ab (Deutschland: minus 0,2 Prozent). Die Wirtschaftsleistung entwickelte sich in Rheinland-Pfalz schwächer als in fast allen anderen Bundesländern.
In jeweiligen Preisen erhöhte sich die Wertschöpfung. Sie stieg um 3,5 Milliarden auf 184 Milliarden Euro, was einer Zunahme um 1,9 Prozent entspricht.
Zum Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts trug insbesondere das Verarbeitende Gewerbe bei, das 21 Prozent der gesamten Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz erwirtschaftet. Die Bruttowertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes sank 2024 um 6,3 Prozent (Deutschland: minus 2,9 Prozent).
Die Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden mit 50 und mehr tätigen Personen mussten gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang von acht Prozent hinnehmen. Damit entwickelte sich die Industrie in Rheinland-Pfalz schwächer als im Bundesdurchschnitt (minus 3,5 Prozent).
Besonders die Hersteller von Investitionsgütern, die etwas mehr als ein Viertel zum Gesamtumsatz der Industrie beitragen, mussten erhebliche Einbußen verkraften (minus 16 Prozent). Infolge der angespannten Wirtschaftslage und der gedämpften Konjunkturaussichten für 2025 sank die Nachfrage nach Investitionsgütern wie beispielsweise Kraftwagen oder Maschinen. Die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, die unter den umsatzstärksten Industriebranchen an dritter Stelle stehen, erzielten rund ein Viertel weniger Umsatz als 2023. Im Maschinenbau, der zweitgrößten Branche gemessen am Umsatz, lagen die Erlöse zwölf Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.
Auch die Umsätze der Vorleistungsgüterproduzenten nahmen 2024 ab (minus 4,1 Prozent). Die rheinland-pfälzische Industrie ist stark auf die Produktion von Vorleistungsgütern ausgerichtet. Sie machen mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der Industrie aus. In Rheinland-Pfalz ist die Chemieindustrie die mit Abstand umsatzstärkste Branche und prägt die Entwicklung in der Vorleistungsgüterindustrie. Die Erlöse der Chemiebranche schrumpften 2024 um 3,4 Prozent. Die geringeren nominalen Umsätze könnten sich jedoch teilweise durch sinkende Erzeugerpreise für chemische Erzeugnisse erklären.
Die Hersteller von Konsumgütern verbuchten ebenfalls geringere Erlöse; gegenüber dem Vorjahr betrug der Umsatzrückgang 5,6 Prozent. Der Anteil der Konsumgüterproduzenten am gesamten Industrieumsatz betrug 18 Prozent.
Der Dienstleistungssektor, der 68 Prozent zur gesamten Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz beiträgt, erholte sich 2024 teilweise von dem kräftigen Einbruch im Jahr zuvor. Die Bruttowertschöpfung nahm preisbereinigt um 0,8 Prozent zu und damit nur geringfügig weniger als im Bundesdurchschnitt (plus 0,9 Prozent).
Zwei der drei Teilbereiche des Dienstleistungssektors entwickelten sich positiv. Am stärksten stieg die Bruttowertschöpfung des Teilsektors „Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit“ (plus 1,8 Prozent; Deutschland: plus 1,7 Prozent). Im Teilsektor „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ nahm die Bruttowertschöpfung 2024 ebenfalls zu (plus 0,6 Prozent; Deutschland: plus 0,7 Prozent). Die Wirtschaftsleistung des Teilsektors „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen“ stagnierte hingegen nahezu; sie nahm um 0,1 Prozent ab (Deutschland: plus 0,3 Prozent).
Für das Baugewerbe, das sechs Prozent zur gesamten Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz beiträgt, waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin schwierig. Hohe Preise für Bauleistungen und Baustoffe sowie ein hohes Zinsniveau belasteten die Baukonjunktur. Die Zahl der Baugenehmigungen sank auf einen neuen Tiefstand. Die Bruttowertschöpfung im Baugewerbe verringerte sich preisbereinigt um 2,7 Prozent (Deutschland: minus 3,7 Prozent).
Die nominalen – also nicht preisbereinigten – Umsätze im Baugewerbe legten 2024 weiter zu. Im Bauhauptgewerbe erhöhten sich die baugewerblichen Umsätze der Betriebe von Rechtlichen Einheiten mit 20 und mehr Beschäftigten um 1,6 Prozent (Deutschland: plus 0,7 Prozent). Das Wachstum ist auf die günstige Entwicklung im Tiefbau zurückzuführen, der seine Umsätze um 7,1 Prozent steigerte. Die baugewerblichen Umsätze des Hochbaus nahmen dagegen um 4,9 Prozent ab, was auf die anhaltende Schwäche des Wohnungsbaus zurückzuführen ist. Das Ausbaugewerbe entwickelte sich 2024 erneut deutlich positiver als das Bauhauptgewerbe, was mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach energetischer Sanierung zusammenhängen könnte. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die ausbaugewerblichen Umsätze um zwölf Prozent (Deutschland: plus 3,3 Prozent).
Im Jahr 2024 wurden Waren im Wert von 56,5 Milliarden Euro aus Rheinland-Pfalz ins Ausland geliefert; das waren 5,3 Prozent weniger als im Vorjahr (Deutschland: minus 1,2 Prozent). Der Rückgang betraf alle Güterhauptgruppen. Vergleichsweise moderat waren die Einbußen bei der Ausfuhr von Vorleistungsgütern einschließlich Energie, die 2024 um 2,6 Prozent sank. Beim wichtigsten Exportgut „Chemische Grundstoffe, Düngemittel und Stickstoffverbindungen, Kunststoffe in Primärformen und synthetischer Kautschuk in Primärformen“ gab es sogar einen Zuwachs von 2,2 Prozent. Mit minus elf Prozent nahmen die Exporte von Investitionsgütern besonders stark ab; dazu trug ein kräftiges Minus bei der Ausfuhr von Kraftwagen und Kraftwagenteilen bei. Neben konjunkturellen Einflüssen könnte sich hier auch der Strukturwandel der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität bemerkbar machen, der Anpassungsdruck bei den heimischen Automobilherstellern sowie ihren Zulieferern erzeugt. Auch der Wert der exportierten Maschinen nahm deutlich ab. Der Wert der ins Ausland gelieferten Konsumgüter war ebenfalls wesentlich geringer als im Vorjahr. Er schrumpfte um 8,8 Prozent.
Auf alle Kontinente wurden 2024 weniger Waren aus Rheinland-Pfalz geliefert. Die Ausfuhren in europäische Länder nahmen um 4,1 Prozent ab.Der Wert der nach Amerika versendeten Waren sank noch stärker (minus 8,2 Prozent), was insbesondere mit einem Rückgang der Exporte in die USA zusammenhängt (minus zwölf Prozent). Die Warenlieferungen nach Asien verringerten sich ebenfalls spürbar (minus 6,9 Prozent). Ein wesentlicher Grund dafür sind die Ausfuhren nach Japan, die sich ausgehend von einem außergewöhnlich hohen Vorjahresniveau um gut ein Viertel reduzierten. Die Warenlieferungen in das bedeutendste Abnehmerland in Asien, die Volksrepublik China, waren ebenfalls rückläufig (minus zwei Prozent).
Der Wert der Einfuhren nach Rheinland-Pfalz nahm 2024 um 4,3 Prozent ab. Die schwache Binnenkonjunktur dürfte zum Rückgang der Nachfrage nach Vorleistungs- und Investitionsgütern aus dem Ausland beigetragen haben. Die Konsumgüterimporte sanken ebenfalls, das Minus fiel aber wesentlich geringer aus.
Der Verbraucherpreisindex, dessen Veränderung gegenüber dem Vorjahr als Maß für die Inflation verwendet wird, erhöhte sich 2024 im Jahresdurchschnitt um 2,6 Prozent (Deutschland: plus 2,2 Prozent). Damit war die Inflationsrate 2024 zwar noch nicht einmal halb so hoch wie im Vorjahr, trotzdem lag sie das vierte Jahr in Folge über der für die Geldpolitik im Euroraum wichtigen Zwei-Prozent-Marke. Darüber hinaus war die Teuerung deutlich höher als im langjährigen Durchschnitt: Von der Einführung des Euro im Jahr 1999 bis 2024 stiegen die Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz durchschnittlich nur um 1,8 Prozent pro Jahr.
Um längerfristige Trends bei der Preisentwicklung unabhängig von den schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreisen zu erkennen, wird die Veränderung des „Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie“ im Vergleich zum Vorjahr betrachtet; sie wird auch als Kerninflationsrate bezeichnet. Die Kerninflationsrate lag 2024 im Jahresdurchschnitt bei plus 3,1 Prozent (Deutschland: plus drei Prozent). Sie war somit höher als die allgemeine Teuerungsrate, was mit den überdurchschnittlichen Preissteigerungen bei Dienstleistungen zusammenhängt. Während sich Waren, zu denen unter anderem auch Nahrungsmittel und Energie gehören, im Jahresdurchschnitt nur um 1,1 Prozent verteuerten, stiegen die Preise für Dienstleistungen um vier Prozent. Diese Preiserhöhungen dürften unter anderem auf Lohnsteigerungen zurückzuführen sein, die sich bei Dienstleistungen aufgrund der hohen Personalintensität stärker auf die Produktionskosten auswirken als bei Waren. Beispielsweise dürfte sich in einigen Dienstleistungsbereichen die Anhebung des Mindestlohns von zwölf Euro auf 12,41 Euro pro Stunde im Januar 2024 bemerkbar gemacht haben.
Im Jahr 2024 waren in Rheinland-Pfalz 2,06 Millionen Personen erwerbstätig. Die Erwerbstätigkeit lag somit etwas unter dem Rekordniveau des Vorjahres (minus 3.300 Personen bzw. minus 0,2 Prozent). Von dem Rückgang waren sowohl die Industrie und das Baugewerbe als auch die meisten Dienstleistungsbereiche betroffen. Nur im stark staatlich geprägten Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit” stieg die Erwerbstätigenzahl. Bundesweit wuchs die Gesamtzahl der erwerbstätigen Personen leicht um 0,2 Prozent.
Der langfristige rückläufige Trend bei der Selbstständigkeit setzte sich fort. In Rheinland-Pfalz arbeiteten 1,6 Prozent weniger Selbstständige als im Vorjahr. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der geringfügig Beschäftigten blieb nahezu unverändert (minus 0,1 bzw. plus 0,1 Prozent).
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nahmen aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur deutlich zu. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 120.600 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer arbeitslos gemeldet. Das waren 9.800 Personen bzw. 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr (Deutschland: plus 6,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent (Deutschland: plus 0,3 Prozentpunkte auf sechs Prozent). Im Ländervergleich hat Rheinland-Pfalz trotzdem weiterhin die drittniedrigste Arbeitslosenquote hinter Bayern (2024: 3,7 Prozent) und Baden-Württemberg (4,2 Prozent).
Der Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ließ 2024 spürbar nach. Der Bundesagentur für Arbeit wurden im Jahresdurchschnitt 37.000 offene Arbeitsstellen gemeldet und damit 4.900 Stellen bzw. zwölf Prozent weniger als im Vorjahr (Deutschland: minus 8,8 Prozent).